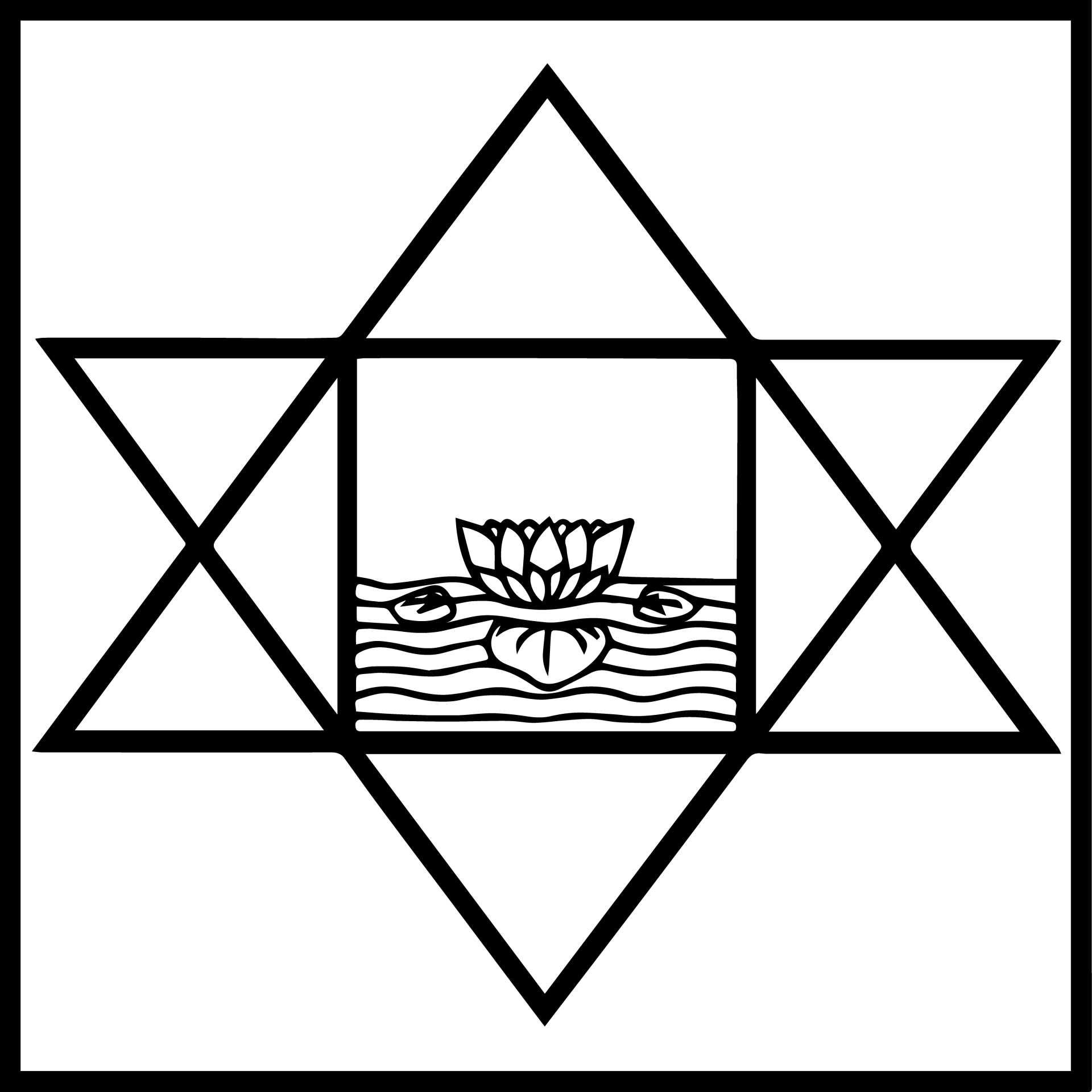Achtes Buch
Das Buch vom Tod
Dritter Canto
Tod im Wald
Hier war es nun, in dieser herrlich goldnen Morgenröte.
Bei ihrem noch schlafenden Gemahl liegend, schaute sie
Auf ihre Vergangenheit, wie ein Sterbender
Zurückblickt auf die sonnigen Felder des Lebens,
Wo auch er mit den Anderen tollte und spielte,
Sein Haupt hochhaltend im dunklen mächtigen Strom,
In dessen Tiefen er für immer eintauchen muss.
Alles, was sie gewesen war und getan hatte, erlebte sie wieder.
So sauste das ganze Jahr im raschen und wirbelnden Lauf
Von Erinnerungen durch sie hindurch und floh
In die unwiederbringliche Vergangenheit dahin.
Still stand sie dann auf und, nach verrichtetem Dienst,
Verneigte sich vor der großen Göttin, schlicht gemeißelt
Von Satyavan in einen Stein des Waldes.
Ihre Seele und Durga wussten, welch Gebet sie flüsterte.
Womöglich spürte sie in dem düsteren mächtigen Wald
Die unendliche Mutter wachen über ihr Kind,
Womöglich sprach die verhüllte Stimme ein leises Wort.
Und dann trat sie vor die blasse Mutter Königin.
Sie sprach, aber mit verhaltenen Lippen und ruhiger Miene,
Damit nicht ein beiläufiges Wort oder verräterischer Blick
In die ahnungslose Brust der Mutter sich stehle,
Erschlagend alles Glück und Bedürfnis zu leben,
Ein schlimmes Vorgefühl des kommenden Leids.
Nur das Notwendigste wurde ausgesprochen:
Alles andere drängte sie zurück in ihr gequältes Herz
Und zwang ihrer Rede einen äußeren Frieden auf.
„Ein Jahr ist es nun, dass ich mit Satyavan
Hier am smaragdgrünen Saume der weiten Wälder lebe,
Im ehernen Ring der gewaltigen Gipfel
Unter den blauen Spalten im Waldeshimmel,
Und ich bin weder in die Schweigsamkeiten
Dieser großen Waldungen gegangen, die meine Gedanken
Geheimnisvoll umgeben, noch in ihrer grünen Wunderwelt
Gewandert, sondern diese kleine Lichtung war mir meine Welt.
Nun aber hat ein starker Wunsch mein ganzes Herz ergriffen,
Mit Satyavan zu schreiten an seiner Hand
In jenes Leben, das er geliebt hat, die Pflanzenwelt berühren,
Die er durchschritten hat, die Waldblumen zu kennen
Und in Ruhe den Vögeln zu lauschen und dem wuselnden Leben,
Das kommt und geht, dem reichen fernen Rascheln der Zweige
Und all dem mystischen Geflüster des Waldes.
Gib mich nun frei und lass mein Herz Ruhe finden.“
Sie antwortete: „Tue, was dein weiser Verstand verlangt,
O stilles Königskind mit den Augen, die herrschen.
Ich halte dich für eine starke Göttin, die gekommen ist,
Sich unserer öden Tage zu erbarmen; so dienst du
Wie es eine Sklavin täte und stehst doch jenseits
Dessen, was du tust und was unser Verstand begreift,
So wie die starke Sonne, die von oben her der Erde dient.“
Da gingen der todgeweihte Mann und die Gemahlin, die wusste,
Vereint Hand in Hand in diese feierliche Welt,
Wo Schönheit und Pracht und wortloser Traum,
Wo das mystische Schweigen der Natur zu spüren war
In Kommunion mit Gottes Heimlichkeit.
An ihrer Seite schritt Satyavan voller Freude,
Da sie mit ihm durch seine grünen Lieblingsplätze zog:
Er zeigte ihr den ganzen Reichtum des Waldes, Blumen
In allen Düften und Farben
Und geschmeidig dichte Ranken, rot und grün,
Und seltsam gefiederte Vögel, die jedem süßen Ruf,
Der da heimsuchte ferne Zweige, noch lieblicher Antwort gaben
Mit des schrillen Sängers Namen.
Er sprach von all den Dingen, die er liebte: sie waren
Die Kameraden seiner Kindheit und seine Spielgefährten,
Zeitgenossen und Begleiter seines Lebens
Hier in dieser Welt, deren Stimmungen er kannte:
Ihre Gedanken, die leer waren für das gewöhnliche Mental,
Teilte er, spürte auf jede wilde Gefühlswallung
Eine Antwort. Sie lauschte innig, tief in sich aufzunehmen
Die Stimme, die bald von zärtlichen Worten ließe,
Und deren geliebten Tonfall zu wahren
Für einsame Erinnerung, wenn niemand mehr neben ihr ging
Und die geliebte Stimme nicht mehr erklingen konnte.
Doch achtete sie kaum auf das Gesagte;
An Tod dachte sie, nicht an Leben oder des Lebens einsames Ende.
Liebe, in ihrer Brust versehrt von der scharfen Schneide
Der Qual, klagte bei jedem Schritt vor Schmerz
Und schrie: „Jetzt, jetzt vielleicht verstummt seine Stimme
Auf alle Zeiten.“ Beängstigt von irgend vager Berührung schon,
Blickten zuweilen ihre Augen umher
Wie um den finsteren und fürchterlichen Gott sich nahen zu sehen.
Satyavan aber hatte innegehalten. Er wollte beenden
Die Arbeit hier, damit sie beide glücklich, vereint und unbekümmert
Weiterwandern könnten durch das grüne tiefe
Urzeitliche Geheimnis im Herzen des Waldes.
Einen Baum, der ruhig sein Haupt gen Himmel hob
In strotzender Üppigkeit, herbeirufend
Den Wind mit seinem verliebt weitem Gezweig,
Den wählte er und mit seinem Stahl nahm er den Ast in Angriff,
Braun, rau und stark, verborgen in seinem smaragdgrünen Kleid.
Wortlos, doch ganz nah, sah sie zu, um keine Regung
Von diesem geliebten hellen Gesicht und Körper zu verlieren.
Ihr Leben lief nun in Sekunden ab, nicht in Stunden,
Und sparsam ging sie um mit jedem Augenblick
Wie ein fahler Kaufmann, der sich über seinen Vorrat beugt,
Der Geizhals mit dem armseligen Rest seines Goldes.
Satyavan jedoch schwang eine freudige Axt.
Er sang in hohen Tönen eines Weisen Choral,
Der von besiegtem Tod und erschlagenen Dämonen erklang,
Und manchmal hielt er inne, um ihr süße Worte zuzurufen
Voll Zärtlichkeit und Neckerei, lieblicher als Liebe:
Sie sprang einer Pantherin gleich jedes seiner Worte an
Und trug sie in ihr Höhlenherz.
Doch als er so am Schaffen war, da kam sein Verhängnis über ihn.
Die gewaltsamen und hungrigen Hunde des Schmerzes
Durchstreiften seinen Körper und packten beim Vorüberziehen
Lautlos zu, und bestürmt rang sein schmerzvoller Atem damit,
Des Lebens starke Herzstricke zu zerreißen und frei zu sein.
Dann half, als ließe ein wildes Tier seine Beute los,
Ein Augenblick in einer Woge großer Erleichterung,
Und er stand neugeboren da an Kraft und frohem Wohlgefühl
Und frohlockend nahm er sein zuversichtlich Werk wieder auf
Doch mit weniger gezielten Hieben. Nun aber schlug
Der große Holzfäller nach ihm und das Mühen erlahmte: erhebend
Noch seinen Arm, warf er die scharfe Axt
Weit von sich weg wie ein Instrument der Pein.
Sie kam zu ihm in stiller Pein und nahm ihn in die Arme,
Und er rief ihr zu: „Savitri, ein Schmerz
Spaltet mir Haupt und Brust, als würde die Axt
Mich durchdringen statt den lebenden Ast.
Solche Qual zerreißt mich wie wohl der Baum fühlen muss,
Wenn gefällt er sein Leben verlieren muss.
Lass eine Weile meinen Kopf in deinem Schoße ruhen
Und behüte mich mit deinen Händen vor üblem Los:
Vielleicht geht durch dein Berühren der Tod vorbei.“
Da setzte sich Savitri unter weite Zweige,
Kühl, grün vor der Sonne, nicht unter dem geschundenen Baum,
Den seine scharfe Axt gespalten hatte, – diesem blieb sie fern;
An glückverheißenden königlichen Stamm gelehnt
Wachte sie über ihn in ihrem Schoße und suchte
Mit ihren Händen die Qual der Stirn und des Körpers zu mildern.
Aller Kummer und alle Angst waren nun gänzlich tot in ihr
Und eine große Ruhe war eingetreten. Der Wunsch zu lindern
Sein Leiden, der Impuls, der sich dem Schmerz widersetzt,
Blieb als einzig sterbliches Gefühl zurück. Es verging:
Ohne Kummer und voll Stärke harrte sie den Göttern gleich.
Doch war jetzt seine lieblich vertraute Farbe gewandelt
In ein fahles Grau, und seine Augen
Getrübt und des klaren Lichtes beraubt, das sie liebte.
Es blieb nur noch das dumpfe und stoffliche Mental,
Leer vom leuchtenden Blick des hellen Geistes.
Aber noch einmal, bevor er völlig entschwand,
Rief er in klammernd letzter Verzweiflung aus:
„Savitri, Savitri, O Savitri,
Beuge dich nieder, meine Seele, und küss mich während ich sterbe.“
Und als ihre bleichen Lippen die seinen drückten,
Wurden seine schwächer, verloren sie letzte Süße der Erwiderung;
Seine Wange lag lastend auf ihrem goldnen Arm. Noch suchte sie
Seinen Mund mit ihrem bebenden Mund, als könnte
Sie mit ihrem Kuss seine Seele zur Rückkehr überreden;
Dann nahm sie wahr, dass sie nicht mehr alleine waren.
Gekommen war Etwas, bewusst, groß und schrecklich.
Nahe bei ihr spürte sie einen stillen Schatten, unermesslich,
Der den Mittag mit finsterem Rücken gefrieren ließ.
Eine furchtbare Stille hatte sich über den Ort gelegt:
Der Ruf der Vögel war verstummt, die Stimmen der Tiere.
Ein Grauen und eine Angst erfüllte die Welt,
Als hätte das Mysterium der Vernichtung
Greifbar Gestalt angenommen. Ein kosmischer Geist
Schaute aus furchtbaren Augen auf alles hin,
Verachtend alles mit seinem unerträglichen Blick,
Und mit unsterblichen Lidern und einer weiten Stirn
Sah es in seinem ungeheuren zerstörenden Denken
Alle Dinge und Wesen als einen erbärmlichen Traum,
Verwerfend mit ruhiger Verachtung das freudvolle Glück der Natur,
Mit wortloser Bedeutung seines eindringlichen Blickes
Die Unwirklichkeit bekundend von allen Dingen
Und vom Leben, das ewig sein wollte jedoch nie war,
Und dessen kurze und eitle Wiederkehr ohne Unterlass,
Als ob aus einem Schweigen ohne Form oder Namen
Der Schatten eines fernen sorglosen Gottes
Das illusorische Universum zu seinem eigenen Nichts verdammte,
Das sein Schauspiel von Idee und Tat in der Zeit aufhebt
Und seine Nachahmung von Ewigkeit.
Sie wusste, dort stand der sichtbare Tod
Und geschieden aus ihren Armen war Satyavan.
Ende des achten Buches, "dritter Canto"
Ende des zweiten Teils